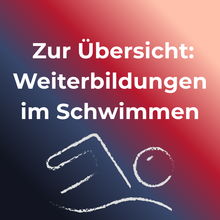Mit Herz und Know-How: Dr. Lilli Ahrendt über unsere Weiterbildungen im Schwimmen

Wo, wenn nicht an der Deutschen Sporthochschule Köln gibt es eine Expertin für das Schwimmen mit Kindern. Im Interview erzählt uns unsere langjährige Referentin Dr. Lilli Ahrendt, warum ihre Schwimmweiterbildungen für Kinder den Unterschied machen können. Denn viele Kinder können heute nicht mehr oder nur schlecht schwimmen - mithilfe der Kurse von Ahrendt können Übungsleiter*innen Kinder besser auf das Element Wasser vorbereiten.
UW: Müssen Säuglinge überhaupt erst ans Wasser gewöhnt werden?
Dr. Lilli Ahrendt: Biologisch betrachtet sind sie natürlich im Fruchtwasser, also im Wasser, herangewachsen. De facto ist es aber so, dass sie mit der Abnabelung Landlebewesen werden und sich damit die Lunge mit Luft füllt. Nun ist es lebenswichtig, Luft von Wasser zu unterscheiden. Wenn also dem Kind Wasser übers Gesicht läuft, setzen frühkindliche Schutzreflexe ein und es hält den Atem an. Das sind Reize einer neuen Welt, die das Kind nicht aus dem Mutterleib kennt.
Inwiefern unterscheiden sich die Weiterbildungskurse Säuglings-, Kleinkind- und Kinderschwimmen voneinander?
Im Säuglingsalter entwickelt sich das Urvertrauen des Menschen. Eltern und Kind bauen eine enge Bindung miteinander auf durch intensiven Blick- und Körperkontakt beim Halten, Tragen, Beruhigen und Füttern. Diese Entwicklungsphase ist einmalig und lässt sich später nicht nachholen. Außerdem werden verschiedene Anpassungsprozesse in Gang gesetzt wie die der Wahrnehmung, der Haltungs- und Bewegungskontrolle. Im Vordergrund der Elternschulung stehen daher die Wassergewöhnung sowie das Halten und Sichern des Kindes.
Das Kleinkindschwimmen in der Autonomiephase des Kindes stellt Eltern und Kursleiter vor ganz andere Herausforderungen, denn Gefahren erkennt das Kind nicht und es entstehen Konflikte zwischen Eltern und Kindern rund um das Thema Erziehung, Sicherheit und Unfallprävention. Eltern sind nun gefordert, mal Vorbild und Spielpartner, mal Tröster und Spielverderber zu sein.
Im Kindergartenalter wird Wasser ein spannender Bewegungsraum, den es mit allen Sinnen gemeinsam mit Gleichaltrigen zu entdecken gilt. Die Eigenschaften des Wassers, die Bewegungsmuster und Grundfertigkeiten wie das Luftanhalten, Ausatmen und Untertauchen, das Schweben und Gleiten, das Springen und Fortbewegen werden nun schrittweise ausprobiert und durch Wiederholung gelernt.
Kann man beim Schwimmenlernen sagen: Je früher, desto besser?
Der Mensch wird als physiologische Frühgeburt geboren - sein Gehirn benötigt weitere drei Jahre, um sich auszuentwickeln. Dafür bedarf es jedoch vielfältiger Wahrnehmungsreize über die Haut, die Bewegung sowie Erlebnisse des Hörens, Sehens oder Tastens. Die sensomotorische Förderung im Wasser im frühen Kindesalter hilft Kindern die „richtigen Schubladen zu finden“ – Sinnesempfindungen also passend einzuordnen. Wenn Kinder nie ihre Grenzen austesten und erproben konnten, bauen sie später Ängste auf. Kinder sind Weltentdecker, sie brauchen verschiedene Bewegungsräume und Wasser ist dabei ein wichtiger Bewegungsraum und Schwimmen eine wichtige Fertigkeit. Aber letztendlich geht es hier um mehr als Schwimmen. Es geht um das Lernen, die Entfaltung des Menschen im erweiterten Sinn.
Laut der DLRG können rund ein Viertel der Deutschen gar nicht oder nur schlecht schwimmen. Wie könnte man dem entgegenwirken?
Ja, ich glaube, wir brauchen eine engere Beziehung – sowohl zum Kind als auch zum Wasser. Beim Zähneputzen kann man beispielsweise schon in den Zahnputzbecher Blubberblasen machen. Man kann Ausatmen lernen. Man kann Wasser in den Mund nehmen, oder es ausspucken. In den Weiterbildungen zeigen wir den Teilnehmenden durch kleine Spiele und Lieder, wie man Kinder bereits im Alltag „Wasser-schlau“ macht und dem Wasser positiv begegnet – im Planschbecken, am See, im Urlaub.
Wie schaffen wir es langfristig, die Kinder zu motivieren und beim Schwimmen zu halten?
Kinderärzte sollten Eltern über die Wichtigkeit des Schwimmens informieren. Wunderbar wäre es, wenn Eltern ihren Kindern regelmäßigen Wasserkontakt ermöglichen könnten und dies ohne Zeitdruck und in kleinen Lernschritten geschehen würde. Wir dürfen von Kindern nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig verlangen. Es sollte das „Prinzip der Passung“ gelten. Die Aufgabenschwierigkeit muss zum Kind passen. Und jedes Kind ist individuell.

Wodurch heben sich denn unsere Weiterbildungen von anderen Weiterbildungen ab?
Wir als Sportwissenschaftler sind als Referenten breit aufgestellt. Wir haben sowohl Praxiserfahrung im Unterrichten als auch Erfahrungen in der Wissenschaft gemacht. Die Teilnehmer erleben hier nicht nur ein Thema der Weiterbildung in der Theorie, sondern sie lernen sich selbst und die restliche Gruppe in der Praxis kennen. Unsere Weiterbildungen vermitteln die Möglichkeit, Neues zu entdecken, sich zu erproben und ermöglichen so auch persönliche Weiterentwicklungen. Ich hatte mal einen Vater in der Fortbildung „Säuglingsschwimmen“, der gar nicht Kursleiter werden wollte, sondern in drei Monaten Vater wurde und die Weiterbildung für sich persönlich machen wollte. Das fand ich toll!
Was erhoffen Sie sich als Output nach der Weiterbildung, den die Teilnehmenden auf jeden Fall mitnehmen sollten?
Wir haben ganz unterschiedliche Menschen in unseren Weiterbildungen dabei. Jeder bringt etwas in seinem Wissensrucksack mit und sucht nun in der Weiterbildung nach einer Ergänzung. Eine Hebamme kann beispielsweise sehr gut mit Eltern umgehen, aber ihr fehlt noch die Perspektive des Wassers und der Bewegung. Durch die verschiedenen Berufsgruppen und Perspektiven entsteht häufig ein reger Austausch von Erfahrungen, den es dann mit Know-How zu komplettieren gilt. Die große Kunst ist es, im Seminar situativ und anschaulich zu bleiben, individuelle Impulse zu geben und einen vielfältigen Wechsel an Methoden zu nutzen, um die intensiven Stunden nicht mit Wissen zu überfrachten.
Das laufende Erasmus+ Projekt „Aquatic Literacy for all Children (ALFAC)“, an dem auch die Deutsche Sporthochschule beteiligt ist, hat erste Zwischenergebnisse veröffentlicht. Was sagen Sie zu den Ergebnissen?
Erstmal haben Kinder bis zum Alter von neun Jahren ein eingeschränktes räumliches Vorstellungsvermögen und können dadurch Gefahren einfach nicht wie Erwachsene sehen. Allerdings entsteht eben, je älter das Kind wird und je weniger es der Wassersituation gewachsen ist, die Angst vor Blamage und vor allem bei Jungen der Anspruch „mutig sein zu müssen“. Und deswegen ist es wichtig, dass das Kind nicht erst im schulischen Kontext schwimmen lernt. Man sollte zwar in der Schule das Schwimmenlernen weiter fördern, aber die Schule sollte dabei nicht der erste Lernort sein. Hier sind die Kinder bereits häufig zu alt und die Gruppen zu groß. In den Niederlanden erhalten bereits die Vierjährigen eine zweijährige Schwimmausbildung im städtischen Bad. Das kostet Geld, aber es ist ein Muss, und so zahlen es die Eltern mit Selbstverständlichkeit. Hier höre ich stets, dass es einen Mangel an Möglichkeiten und fehlende Bereitschaft gibt.
Okay und weil wir die ganze Zeit übers Schwimmenlernen gesprochen haben, würden wir gerne als Abschlussfrage wissen, ob man es auch wieder verlernen kann?!
Das ist eine gute Frage, bei der man in die Trainingslehre eintauchen muss. Beim Schwimmen geht es um motorisches Lernen und Automatisierung. Da gibt es verschiedene Stufen der Vervollkommnung. Lernen im Anfangsstadium ist abhängig von der Häufigkeit und von der bewussten Bewegungskontrolle. Kinder sind natürlich unterschiedlich gut oder schlecht im Wahrnehmen, Behalten, Anstrengen und Koordinieren von Bewegungen. Ihre Lern- und Leistungsbereitschaft, aber auch die anschauliche Darbietung des Unterrichts kann darüber entscheiden, was man behält oder vergisst. Wer einmal seine Angst vor dem „Untergehen“ überwunden hat, also merkt „ich kann schwimmen“, der verliert diese Fertigkeit nicht mehr. Der Spruch „Übung macht den Meister“ gilt auch heute noch, wenn es um automatisierte Abläufe geht.
Wenn das Interview mit Frau Dr. Ahrendt Sie neugierig gemacht hat, dann bekommen Sie hier alle Informationen hinsichtlich der Weiterbildungen im Säuglings-, Kleinkind- und Kinderschwimmen an der Deutschen Sporthochschule Köln.
Wer sich den kompletten Bericht der Studie "Aquatic Literacy for all Children" durchlesen möchte, findet hier unsere Pressemitteilung dazu.