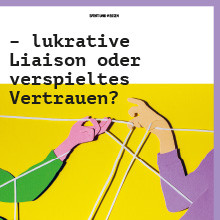Sport in den Medien
Sport ist in unserer modernen Gesellschaft ein omnipräsentes Massenphänomen. Dafür haben vor allem „die Medien“ gesorgt. Früher waren Live-Zuschauer*innen die primäre Zielgruppe von Sportereignissen. Heute ermöglichen Internet, soziale Netzwerke, Fernsehen und Streaming einem breiten Publikum den Zugang. Die Art, wie wir Sport konsumieren, ist also maßgeblich von den Medien abhängig. Dies verändert wiederum den Sport selbst, wie er organisiert und vermarktet wird. Sportevents haben die höchsten Einschaltquoten und Klickzahlen. Sport ist zur Show geworden. Die Medien präsentieren Sport visuell beeindruckend und emotional mitreißend, oft aber auch unausgewogen, kommerziell getrieben und klischeehaft. Das Thema Sport und Medien vollumfänglich abzubilden, ist nahezu unmöglich. Auf nur zwölf Seiten in diesem Magazin sowieso. Daher setzen wir einen Fokus auf drei Aspekte: die Ökonomie des Sports, Sportkommunikation/Sportjournalismus und den Einfluss, den mediale Sportdarstellung auf die Gesellschaft hat.
Machen wirtschaftliche Interessen den Sport kaputt?
Ob Champions-League-Spiele auf Amazon Prime oder Bundesliga-Partien bei DAZN: Der Kampf um Streamingrechte zeigt, dass Sport längst mehr ist als ein Wettbewerb auf dem Spielfeld. Heute ist er ein Milliardengeschäft, in dem Medien, Sponsoren und Vereine um jede Minute Aufmerksamkeit kämpfen. Die Art und Weise, wie Sport medial inszeniert wird, von packenden TV-Übertragungen bis zu viralen Social-Media-Clips, entscheidet darüber, wie Fans ihn erleben und welche Einnahmen daraus entstehen. Sport, Medien und Wirtschaft sind eng verflochten: Sie profitieren voneinander, stehen aber zugleich in einem permanenten Wettstreit um Zuschauer*innen, Klicks und Gewinne. Am Ende dreht sich alles um eines: die Begeisterung des Publikums in wirtschaftlichen Erfolg zu verwandeln. Wir werfen einen Blick auf Themen, die diese Entwicklung prägen: Kommerzialisierung, digitale Plattformen, neue Kommunikator*innen und die Rolle von Sportler*innen.
Die Medienlandschaft rund um den Sport wird immer unübersichtlicher. Nicht nur neue Technologien, auch Tech-Giganten wie Amazon Prime, Apple TV oder Telekommunikationsanbieter wie Magenta mischen den Markt auf. Alle wollen Sport zeigen und treiben mit ihren Geboten für Übertragungsrechte die Preise in die Höhe. Besonders profitieren davon die Top-Clubs im Fußball: „Die Medienrechte sind so teuer geworden, dass es für klassische Medien schwieriger geworden ist, die Einkäufe zu refinanzieren“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Christoph Breuer vom Institut für Sportökonomie und Sportmanagement. Sportarten, die medial weniger präsent sind, etwa Eishockey, Handball oder Volleyball, müssen ihre Einnahmen hauptsächlich über Ticketverkäufe erzielen. Das führt dazu, dass Ligen vergrößert oder zusätzliche Spieltage eingeführt werden, um mehr Zuschauer*innen anzuziehen und ihre Einnahmen zu steigern.
Umkämpfte Aufmerksamkeitsökonomie
Parallel dazu nimmt die „Eventisierung“ von Sportereignissen zu: Super Bowl, Champions-League-Finale oder andere Großevents werden inszeniert wie Partys. Breuer spricht in diesem Zuge von einer „Globalisierung des Mediensports“: Dass sich immer mehr Zuschauer*innen für internationale Ligen, zum Beispiel für die National Football League in den USA, interessieren, führt auch dazu, dass Sender einen Teil ihrer Budgets für ausländische Übertragungsrechte einsetzen. Gleichzeitig verschärft der Eintritt neuer Akteure den Konkurrenzdruck und erschwert es manchen nationalen Sportangeboten, in der stark umkämpften Aufmerksamkeitsökonomie Fuß zu fassen. Digitale Plattformen und Streamingdienste rücken mehr und mehr ins Zentrum der Sportvermarktung. Insbesondere im Fußball ist zu beobachten, dass die teurer werdenden Rechte für Champions-League-Spiele oder internationale Ligen zunehmend bei Streaminganbietern landen, sodass klassische und öffentlich-rechtliche Medien nicht mehr automatisch die Topspiele zeigen können. Für die Sender bedeutet das, ihre Sportstrategie neu auszurichten und gezielter auf Inhalte zu setzen, die für ihr Publikum ebenfalls interessant sein könnten, so Breuer. Gleichzeitig eröffnet die Fragmentierung des Angebots Chancen für kleinere Sportarten, die so eigene Geschichten erzählen, Aufmerksamkeit gewinnen und neue Zielgruppen erschließen können. Auch Social Media und die direkten Kanäle von Vereinen und Athlet*innen verschieben die Kontrolle über Inhalte weg von klassischen Medien und stärken die Position der Sportakteure in der Aufmerksamkeitsökonomie. Wer seine Inhalte clever platziert, bleibt sichtbar in der Informationsflut. Wie daraus langfristig Erlösmodelle entstehen, etwa über Werbung, Paid Content oder die Nutzung von Daten, ist noch offen. Klar ist aber schon jetzt: Sportmedieninhalte werden immer stärker von wirtschaftlichen Interessen gelenkt, wodurch sich klassische Rollenbilder von Medien, Vereinen und Athlet*innen grundlegend verändern.
Individualvermarktung als ökonomische Strategie
Besonders deutlich wird das bei Sportler*innen. Sie werden immer stärker als Persönlichkeiten und Marken wahrgenommen und nicht nur als reine Leistungsträger*innen. „Eigene Social-Media-Auftritte erlauben es ihnen, die Präsenz von Vereins- und Sponsorenmarken zu verlängern, zusätzliche Werbeplattformen zu schaffen und eigene Botschaften zu platzieren“, sagt Prof. Christoph Breuer. Prominente Beispiele wie Serena Williams zeigen, dass Sportler*innen so nicht nur wirtschaftliche Power im Sport selbst, sondern auch übergreifend als Markenbotschafter*innen entwickeln können. Gleichzeitig sind die Spielräume hier unterschiedlich: Während Profisportler*innen in populären Disziplinen und Clubs mit großen Sponsoren umfangreiche Vermarktungsmöglichkeiten haben, müssen Athlet*innen in weniger medial präsenten Sportarten kleinere Schritte gehen. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass die Individualvermarktung von Sportler*innen eine direkte Folge der zunehmenden Aufspaltung der Medienlandschaft ist und immer mehr Teil der ökonomischen Strategie von Sport und Medien wird.
Sport boomt und mit ihm die Sportkommunikation. Streamingriesen wie Amazon und Netflix setzen auf Sportformate; Vereine und Verbände betreiben eigene Medienhäuser; Sportler*innen inszenieren sich längst selbst auf Social Media. Derweil steckt der klassische Sportjournalismus in der Krise: Redaktionen schrumpfen, Reisekosten werden gestrichen, Personal wird abgebaut. Medienwissenschaftler*innen sind sich einig, dass diese Entwicklungen eine schlechtere Berichterstattung über zahlreiche Sportveranstaltungen und Sportarten zur Folge haben. Waren Kommentator*innen früher bei fast jedem Sportevent live vor Ort, werden immer mehr Sportereignisse „remote“ kommentiert – also abseits der Wettkampfstätte.
Vertikalisierung und Owned Media
Gleichzeitig sprießen neue, kommerziell getriebene Sportformate aus dem Boden. Fans können überall und jederzeit Spiele verfolgen, während Teams und Sportler*innen direkten Kontakt zu ihrem Publikum pflegen. Mächtige Sportverbände und finanzstarke Vereine bauen sogenannte vertikale Medienstrukturen auf: Sie bilden eigene Medienhäuser, die die gesamte Kommunikation und Vermarktung steuern. Damit sind sie nicht mehr darauf angewiesen, mit Medienvertreter*innen zusammenzuarbeiten. Stattdessen setzen sie ihre eigenen Themen und bieten durch ihre eigene Medien- und Öffentlichkeitsarbeit (Owned Media) eine hochwertige Berichterstattung, die es ihnen erlaubt, Botschaften selektiv und gezielt zu senden. Ein Beispiel: das IOC. „Mit einer solchen Struktur können Sportveranstalter wie das IOC aber nicht nur eine autonome Berichterstattung mit hoher Qualität realisieren, sondern diese eben auch zu enorm hohen Preisen verkaufen, weil die Nachfrage auf dem Bietermarkt so groß ist“, erläutert Dr. Christoph Bertling, kommissarischer Leiter des Instituts für Kommunikations- und Medienforschung (IKM). Bislang sind es zumeist die großen Player auf dem Sportmarkt, die vertikale Medienstrukturen aufbauen. „Die zunehmende Integration von KI-Technologien wird höchstwahrscheinlich den Trend verstärken. Auch kleinere Sportorganisationen haben die Chance, ihre Medienstrukturen zunehmend zu verfeinern. Hierfür müssten sie allerdings stark in ihre digitalen Grundstrukturen investieren“, ist Bertling überzeugt.
Dass sich Sportarten und -ereignisse den Gesetzmäßigkeiten der Medien anpassen, ist nichts Neues. Aktuell liegen vor allem Kleinfeld-Ligen wie Icon League und Co. im Trend, deren mediale Reichweite vor allem von Influencern, Webvideoproduzent*innen und Twitch-Streamern getragen wird. „Auf den ersten Blick haben diese neuen kompakten Sportformate mit Sonderregeln und Showeffekt nicht direkt etwas mit klassischem Sportjournalismus zu tun. Es handelt sich eher um gut gemachte Unterhaltungsprodukte, aber es gibt einige interessante Schnittstellen zum Wandel im Sportjournalismus“, erklärt Dr. Mark Ludwig, stellvertretender Leiter des IKM. Dies führe mitunter dazu, dass die junge Zielgruppe moderner Sportformate nicht mehr zwischen journalistischen Angeboten und reinen Unterhaltungsformaten unterscheide. Unterhaltung und Journalismus haben sich also immer mehr angenähert. Umso wichtiger: „Auch die Schattenseiten, zum Beispiel Doping, Korruption oder Gewalt, müssen gesehen werden. Das findet natürlich nicht statt, wenn der Sport ein reines PR-Produkt ist“, erläutert Ludwig.
Wie also überlebt der Sportjournalismus? Ludwig sagt: „Sportjournalistische Medien, die Wert auf kritische Berichterstattung und Unabhängigkeit legen, könnten in der Zukunft eine Nische füllen: mit exklusiven Recherchen oder datengetriebenen Analysen.“ So konnten bereits Recherchenetzwerke wie Sportsleaks.com oder Football Leaks weltweit beachtete Enthüllungsgeschichten über Doping, Wettmanipulation oder Korruption platzieren. Der Einsatz digitaler Assistenten in Sportredaktionen kann ebenfalls den Sportjournalismus unterstützen und bereichern (s. S. 16). Keine Frage: Technik, Daten und Künstliche Intelligenz verändern den Sportjournalismus, sowohl was die Produktion von Inhalten als auch was ethische Fragen angeht. Christoph Bertling ist sich sicher: „Eine Auseinandersetzung mit neuen Techniken, ihren Gefahren und Möglichkeiten scheint dabei auch auf der Seite der Sportredaktionen, Sportjournalistinnen und -journalisten unumgänglich.“
Wenn wir an berühmte Sportler*innen denken, haben wir sofort Bilder im Kopf: Jubelszenen, emotionale Interviews, glamouröse Auftritte. Doch die wenigsten von uns kennen die Athlet*innen persönlich. Unsere Wahrnehmung entsteht fast ausschließlich über die Medien. Genau darin liegt ihre enorme Macht; Sportler*innen werden so zu Medienprodukten.
Bereits viele Jahre weiß die Forschung, dass weibliche Athletinnen unabhängig vom Medium (Print, online, TV etc.) in der Sportberichterstattung deutlich unterrepräsentiert sind; der Anteil von Frauensport variiert zwischen zehn und 20 Prozent. Ausgeglichener ist die Berichterstattung lediglich bei Olympischen Spielen. Es wird also in der Regel nicht nur seltener über Sportlerinnen berichtet, sondern auch anders. Man spricht hier vom sogenannen Gender Bias in der Sportberichterstattung.
Diverser und facettenreicher
„Wir haben früher häufig von der Entsportlichung und Trivialisierung der Athletinnen gesprochen, das heißt Sportlerinnen wurden weniger in der Sportausübung, mehr im Privaten gezeigt. Leistung und Erfolge traten eher in den Hintergrund. Das hat sich durchaus verändert; die Berichterstattung über Sportlerinnen ist diverser und facettenreicher geworden“, erklärt Dr. Birgit Braumüller, Abteilung Diversitätsforschung am Institut für Soziologie und Genderforschung. Lange dominierten Frauen in den Medien vor allem die sogenannten „weichen“ Sportarten wie Turnen, Gymnastik oder Volleyball. „Das passte früher zum gesellschaftlichen Bild, Frauen seien weniger stark oder nicht für kontaktintensive Sportarten geeignet“, sagt Dr. Inga Oelrichs vom Institut für Kommunikations- und Medienforschung. Doch auch hier hat sich etwas verschoben: Frauen im Fußball beispielsweise bekommen heute nicht nur mehr mediale Aufmerksamkeit als früher, sondern es wird auch vielfältiger berichtet, zum Beispiel über Aspekte wie Gleichberechtigung und Bezahlung im Fußball.
Des Weiteren ist zu beobachten, dass der Sport von Frauen generell an Bedeutung gewonnen hat und ernster genommen wird. „Es hat einen Wandel in der Geschlechterordnung gegeben und es partizipieren auch mehr Frauen am Sport“, hält Braumüller fest und ihre Kollegin Oelrichs ergänzt noch einen weiteren wichtigen Wert: „Es schafft eine ganz andere Aufmerksamkeit, wenn auch viel über Frauensport berichtet wird. Gerade für Kinder und Jugendliche ist es entscheidend, ob sie starke Sportlerinnen in Spitzenpositionen sehen oder eben nicht.“ Tauchen Frauen im Sport kaum auf, könne dies das Bild vermitteln, sie wären nicht so aktiv oder ihre Leistung wäre nicht gut genug, dass über sie berichtet wird. Besonders die eigenen Social Media-Kanäle geben mittlerweile Sportlerinnen die Möglichkeit, sich so zu präsentieren, wie sie es für gut und richtig erachten. Braumüller: „Manche Sportlerinnen inszenieren vor allem ihr Privatleben, andere betreiben Sponsoring und wieder andere veröffentlichen rein sportbezogenen Content. Sportlerinnen haben dadurch die Möglichkeit, ein größeres Publikum zu erreichen, die Bekanntheit zu steigern und auch Einnahmen zu erzielen.“
„Frauen sehen Frauen anders“
Bei einem Thema legt Dr. Birgit Braumüller aber den Finger in die Wunde: „Die Themen sexuelle und vor allem geschlechtliche Identität von Sportler*innen sehe ich aktuell in der medialen Berichterstattung als problematisch an. Das betrifft häufig Frauen, die nicht weiß sind und nicht den westlichen Idealen entsprechen.“ Ein Beispiel: die Berichterstattung über die algerische Boxerin Imane Khelif, die letztes Jahr in Paris Olympiagold holte. „Bis heute gibt es in den Medien wilde Spekulationen und nicht überprüfte Aussagen über die Geschlechtsidentität von Imane Khelif, die dann bei den Rezipient*innen viele negative und verletzende Reaktionen ausgelöst haben“, erläutert Braumüller.
Um die Wahrnehmung von Sportlerinnen zu verändern, könnte ein Schlüssel in der Zusammensetzung von Sportredaktionen liegen. Aber auch hier ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig. „Frauen sehen Frauen anders“, erklärt Dr. Inga Oelrichs. „Je mehr weibliche Journalistinnen über Sport berichten, desto vielfältiger werden auch die Porträts von Athletinnen.“ Braumüller ist da noch skeptisch. Im Rahmen eines Scoping Reviews beschäftigt sie sich mit Geschlechterdifferenzen bei den Strukturen und Arbeitsbedingungen sowie mit Diskriminierungserfahrungen von Sportjournalist*innen. Während sich also in der Gesamtbetrachtung die Sportkommunikation über Frauen verändert hat, scheinen sich bestimmte Muster hartnäckig zu halten.